|
Jakobsweg
_________________________________________________________________________________
Der Jakobsweg
kann keine Alternative sein
Eigentlich hatte ich mich auf mein schon länger ersehntes
Projekt vorbereitet: Ins Tibet zu reisen, mich an Ort und Stelle
zu organisieren, Führer, Träger zu verpflichten, Lebensmittel
und das notwendige Material zu besorgen. Mit dem Ziel, von Lhasa
in Richtung Basislager des Mt. Everest loszuziehen, um
schlussendlich den Shisha Pangma, 8'013 m über Meer, zu
besteigen.
Nachdem ich vor einigen Jahren den Aconcagua, 7'020 m
(Argentinien), bestiegen habe, war es und ist es mein Ziel,
einen 8'000er zu schaffen.
Mehrere Monate habe ich mich auf dieses Vorhaben vorbereitet und
zwei Monate vorgesehen.
Die politische Lage an Ort, vor allem im Tibet, war fragwürdig
und ich entschied, das Projekt zu verschieben. „ Gehe nie
freiwillig in ein Gebiet, in welchem Unruhe herrscht“.
Was nun mit einem freien Zeitfenster von zwei Monaten?
Vom Jakobsweg habe ich schon einiges gehört, warum nicht?
Ich entschloss mich kurzerhand, mich auf den Weg zu machen.
6. Mai 2009
Als ich in Uster in die S-Bahn stieg, wurde es mir immer
plausibler, ja Klarheit kam auf, dass Genf – Santiago de
Compostella, ca. 2'700 km in zwei Monaten, die ich mir gegeben
habe, nicht zu schaffen sind.
In Zürich hatte ich bis zum Anschlusszug eine halbe Stunde
Aufenthalt. Ich begab mich ganz spontan zur
SBB-Informationsstelle und erkundigte mich, wie ich wohl in eine
Stadt zwischen Genf und St. Jean Pied de Porc komme. Da in
Frankreich die Bahnlinien vor allem Nord-Süd existieren, kam
eigentlich nur Cahors in Frage. Für mich einen guten
Ausgangspunkt mit etwa 800 km weniger Fussweg bis zum Ziel.
„Ja, könnte klappen“ sagte die freundliche Dame am Schalter.
Die Reise führte mit dem TGV, 1. Klasse versteht sich, von
Zürich Hauptbahnhof nach Paris Gare de l’Est. Weiter ging’s mit
der Metro zur Gare d’Austerlitz. Bereits da dachte ich mir, ob
ich wohl doch zuviel Ware eingepackt habe; nun das Gepäck war
nun einmal da.
Die zwei Stunden Aufenthalt verbrachte ich mit Warten. Ich
nutzte die Zeit und schaute im Büchlein nach „Der Weg ist das
Ziel“ von Birgit Götzmann, Conrad Stein Verlag, was für mögliche
Unterkünfte sich in Cahors anbieten. Den ersten Gîte, den ich
anrief, war positiv. Es hatte noch eine Schlafstelle in einem
Dreierzimmer. Mit einem „Schnellzug“ mit vielen Haltestellen
konnte ich direkt nach Cahors reisen. Meine Reise ab Zürich nach
Cahors betrug 15 Stunden.
Im Gîte d’étape „Le Ralais des Jacobins“, den ich nach meinem
ersten Fussmarsch in dreiviertel Stunden erreichte, erhielt ich
einen freundlichen Empfang. Ich konnte gleich mein
Dreibettzimmer beziehen.
Als ich runter ging, befanden sich bereits 8 weitere Wanderer im
Gästeraum und waren bereits beim Abendessen. Die Suppe war
bereits serviert und der Inhalt der grossen Schüssel, die auf
der Tischmitte stand, war vollständig aufgegessen. Die
Wirtsleute, das heisst die Gastgeberin und zugleich Köchin,
machte sich daran, mir eine
frische Suppe zu holen. Bevor dies geschah, gab ich ihr
freundlich zu verstehen, dass ich keine möchte. Das Essen war
tip-top: gemischter Reis mit einer Art Coque-au-vin. Dieser war
ungewohnt zubereitet: Ohne Wein, dafür mit viel Kräuter, Rosinen
und mit Speckwürfeli bestückt. Das Ganze hatte einen asiatischen
Einschlag, wie übrigens auch die Gastgeberin.
Nach dem Nachtessen begab ich mich noch in das schöne Städtchen
Cahors. In einer Brasserie an der Hauptstrasse bestellte ich mir
einen Kaffee obwohl ich wusste, dass der Kaffee in Frankreich in
der Regel scheusslich schmeckt.
Ja, dachte ich mir, du gehst eine Reise an und du landest
irgendwo im Süden Frankreichs.
Zurück in meiner Unterkunft schlief die Dame im Bett Nr. 3
bereits tief. Dass es sich um eine Frau handelte, erkannte ich
an den Händen.
So leise wie möglich machte ich im Nebenraum meine notdürftige
Abendtoilette, bevor ich in mein Bett kroch.
7. Mai 2009
Als ich aufstand, lag meine Zimmergenossin immer noch im
Tiefschlaf.
Nach einem kargen Frühstück (schwarzer Kaffee mit ein paar
Stückchen Baguette, ich dünkle dieses Brot gerne in der
schwarzen Brühe), machte ich mich an die Organisation meines
ersten Marschtages. Von „Cahors“ nach „Montcuq“ (das q spricht
man aus).
Ich verabschiedete mich bei meinen Gastgebern und lief los. Ich
hatte vorgängig in Erfahrung gebracht, dass es einen
Gepäckträgerdienst gibt, welcher beliebiges Gepäck von der
ursprünglichen zur nächsten Destination transportiert. Diese
Dienstleitung von „Rapid-bac“ kam mir sehr gelegen, da ich
schweres Gepäck hatte, zwei volle Rucksäcke. So konnte ich einen
Rucksack mit allem, was ich für den aktuellen Tag nicht
benötigte, stehen lassen. Dieser wurde beschriftet mit Name und
Destination, das heisst Ort und Unterkunft. Dazu legte man 8
Euro, eine Pauschale die gebräuchlich war.
Ab dem „Pont Valenté“ ging’s los, einen steilen Hang hinauf. Der
Weg war durchzogen mit felsigen, steinigen Abschnitten und mit
vielen, in den Fels geschlagenen Treppen. Die Aussicht auf „Cahors“
und übers Land war einzigartig. Die baumähnlichen
Ginstersträucher waren ungewohnt gross und in voller Blüte.



In dieser ersten Etappe habe ich gleich festgestellt, dass ich
nicht als Orientierungs-läufer geboren war. Viermal habe ich
mich an diesem Tag verlaufen. Das vierte Mal hat mich 12
zusätzliche km gekostet oder ein Viertel mehr der geplanten 40
km. Ich musste ja mein Tagesziel erreichen, da mich dort mein
Gepäck erwartete.

Es hat sich gelohnt. Der Weg führte durch die Rebgüter von „Cahors“.
Die kräftigen Rebstöcke, der weisse Kalksteinboden und die warme
Sonne des Südens Frankreichs wie auch das sichtlich grosszügige
Schneiden der Reben zeugt für einen guten, wenn nicht
hervorragenden Wein.

Auf dem Weg kam ich mit einem Bauer ins Gespräch, der sich auf
seinem Hof bei seinen Rindern befand. Ich begrüsste ihn mit “Je
vous souhaite beaucoup de chance dans l’Ecurie“, das soviel
heisst wie « Glück im Stall „. Er quittierte diesen Gruss mit
erstaunten Augen und freudigem Gesicht. Wir sprachen eine Weile
und ich ging weiter.
In einem kleineren Dorf, das ich durchquerte, bemerkte ich das
Schild an einem wunderbaren alten, aber völlig in Stand
gestelltem Haus, „A Vendre“.
Ich trat in den grossen, mit vielen Blumen und wunderbaren
Bäumen bestückten Garten ein. Eine ältere freundliche Dame kam
auf mich zu und begrüsste mich.
Ich erfuhr, dass sie und ihr Ehemann das Haus, ein grosses,
Sechszimmer- Herrschaftshaus mit 2,7 ha Umschwung und gedecktem,
grossen Aussenschwimmbad, verkaufen möchten, um in „Montpelier“
eine Eigentumswohnung zu kaufen.
Das ganze Anwesen, ein Bijou, ist seit zwei Jahren auf dem Markt
und für 370‘000 Euro nicht verkäuflich.
Wie ich später erfahren habe, sind die Liegenschaftspreise in
dieser Gegend in den zwei letzten Jahren dramatisch in den
Keller gefahren. Vierzig bis fünfzig Prozent sind nicht die
Ausnahmen. Vor allem Engländer, die vor Jahren im Süden
Frankreichs Eigentum erworben haben, wollen heute verkaufen.
Im grosszügigen Wohnraum unterhielten wir uns bei einem kühlen
Getränk. Eine sympathische Begegnung.


Nach über sieben Stunden Marschzeit sitze ich in „Montcoq“ in
einem Strassencafé bei einem gespritzten Weissen, obwohl dieses
Getränk hier nicht bekannt ist. Ich mixte mir das Ding selbst
zurecht.
Das Gästehaus, welches ich aufsuchte, hatte ich am Vorabend
reserviert. Es beherbergte zwei Gästezimmer in einem alten aber
gepflegten Gebäude. Ich konnte ein Doppelzimmer mit separater
Dusche alleine benutzen, was mir sehr recht war. Der Vermieter,
etwas über Fünfzig, Immobilienhändler, der in diesem Haus
geboren ist, hat das Geschäft von seinem Vater übernommen.
Gleich konnten wir, die Chemie stimmte, ein gutes Gespräch
führen. Diese Unterkunft kostete Fünfzehn Euro.
In einer Brasserie am Dorfplatz nahm ich den Apero ein, ich
bestellte gleich eine Flasche Roten und zwar Wein aus „Cahors“.
Später verlangte ich die Speisekarte. Auf meine Frage an die
Köchin, welches Fleisch ich bestellen solle, kam die Antwort
spontan: Entrecôtes und Frites. Ausnahmsweise hat sie mir an
Stelle der Frites Bohnen gemacht. Das Ganze war OK. Ich
bestellte nochmals eine Flasche mit dem Gedanken, der
Serviertochter und der Köchin ein Glas zu offerieren. Doch damit
war nichts, beide lehnten höflich ab. Somit blieb mir nichts
anderes übrig als die zweite Flasche alleine zu trinken. Doch
mit einem Stück Blaukäse passte dies ausgezeichnet. Ich kam noch
mit jüngeren Leute ins Gespräch, die ein grosses Interesse für
die Schweiz zeigten. Das bewog mich, eine Runde zu offerieren.
Die Jungs waren nicht abgeneigt und so ging es weiter.
8. Mai 2009
Da für den nächsten Tag Regen angesagt war, habe ich mich
entsprechend ausgerüstet. Mein Ziel war „Lauzerte-L’Auberge de
l’Aube Nouvelle“. Auch an diesem grauen Tag habe ich mich
vermehrt verlaufen.
Viele Wege führten durch bewaldetes Gebiet. Wunderbare Hohlwege.
Ich dachte an Wilhelm Tell: „durch diese hohle Gasse muss er
kommen“, der satanische Gessler, der danach lebensunfähig war.
„Lebensunfähig?“, ja, er war danach eben nicht mehr am Leben.
Weiter an einem Bauernhof vorbei. Es sah wie in einer Müllgrube
aus. Dieser Hof „Bonal“ wird mir in Erinnerung bleiben. Es war
von Getränken und Nusskuchen die Rede. Meine Gedanken waren bei
einer Bündner oder Walliser Nusstorte. Ich machte mich auf dem
Hof bemerkbar. Der Hofhund, weissschwarzer Schäfer, beobachtete
mich lauernd. Als mich die Bäuerin grusslos an einen schäbigen
Tisch, der sich am Wegrand befand, verwies, folgte ich den
Anweisungen.
Ich hatte mich kaum bewegt und schon spürte ich das Zubeissen an
meiner linken Wade. Ich wendete mich um wie eine Sprungfeder und
schrie „salle cabot je te fout en l’air“, was ich hier lieber
nicht übersetzen möchte. Ja, er hatte mich richtig erwischt. Ein
Fangzahn hatte sich in den Muskel eingebohrt. Mit der schärfsten
Klinge meines „Leatherman“ habe ich die Wunde zusätzlich
aufgeschnitten so, dass es richtig blutete und desinfizierte das
Ganze mit Schnaps aus meinem Flachmann. Die Alte versuchte alle
Ausreden zu finden, welchen ich keine Beachtung schenkte.
Das ausgetrocknete, unappetitliche Nusstörtchen habe ich den
Hofkatzen verfüttert, die allem Anschein nach ausgehungert
waren.
Nach dem ganzen Abenteuer dachte ich mir, gut habe ich mein
„Krokodil-Dandy“- Messer, welches ich bei Expeditionen bei mir
trage, nicht gezückt.
Auch an diesem Tag habe ich mich wieder mal gehörig verlaufen.
Dies merkte ich, als ich ein vorbeifahrendes Auto anhielt und
nach dem „Gîte Saint Martin“ fragte. Nach meiner Meinung müsste
ich eigentlich gleich da sein. Das war überhaupt nicht der Fall,
ich muss im Kreis gelaufen sein. Der freundliche Mann am Steuer
des Fahrzeugs erklärte mir, dass mein Ziel noch ca. 12 bis 15 km
entfernt sei. Wahrscheinlich beobachtete er mein Gesicht, in dem
eine riesige Endtäuschung abzulesen war. Spontan meinte er, „ich
fahre Sie hin“. Ich überlegte nicht zweimal, warf den schweren
Rucksack in den Kofferraum und stieg dankend auf den
Beifahrersitz des bescheidenen Fahrzeugs. Erst dann bemerkte ich
die zwei Knaben auf dem Rücksitz, die vor sich hin kicherten.
Die dachten sicher, was will dieser Fremde allein und verlassen
auf dieser einsamen Strasse. Der Fahrer und ich unterhielten uns
über Belangloses, bis er mir sagte, dass wir gleich da sind. Ich
versuchte ihm möglichst unauffällig zu verstehen zu geben, dass
er nicht bis in den Weiler fahren möchte. Ja, stimmt ich wollte
nicht, dass man mich aus einem Wagen steigen sieht.
Nachdem ich meinen Rucksack aufgeschnallt hatte, begab ich mich
zu Fahrerseite und wollte den beiden Buben je zehn Euro
überreichen. „Pour la tirlire“, habe ich mit einem Augenzwinkern
gesagt. Aber „ohalätz“. Da hat sich der Vater der beiden Buben
energisch zur Wehr gesetzt und klar gesagt „das kommt überhaupt
nicht in Frage“. Eine Widerrede wäre da aussichtslos gewesen.
Der „Gîte Saint Martin“ steht in einem sehr kleinen Weiler und
das kleine Kirchlein rundet diese Idylle ab.

Im „Gîte Saint Martin“ konnten wir einen Arzt anrufen um zu
erfahren, ob eine Tetanusimpfung notwendig sei. Zum Glück hatte
ich meine Impfausweise dabei. Da meine Tetanusimpfung noch bis
2013 gültig ist, konnte der Arzt mir versichern, dass eine
zusätzliche Impfung für die beschriebene Wunde nicht notwendig
sei. Auf meine Frage konnte er mir auch bestätigen, dass in der
Region keine Tollwut bekannt sei, was mich sehr beruhigte.
Ja, es war ein schöner Abend bei Georgina, Engländerin, und
Antony, Franzose.
Bevor die beiden Töchterchen, vier und sechs Jahre, schlafen
gehen mussten und sich höflich verabschiedeten, spielte ich
ihnen noch etwas auf meiner Mundharmonika vor.

Auch die weiteren Gästen, wir waren etwa zwölf Personen am
Tisch, waren entzückt.
Antony und ich haben uns noch bis tief in die Nacht bei einer
Flasche Armagnac unterhalten. Er hat mir seine Lebensgeschichte
erzählt. Von seiner Passion Sportwagen und dem Rallyefahren. Die
im ganzen Haus verteilten Schaukästen, gefüllt mit
Miniatursportautos, bestätigen dies.
Seine Erzählungen über die unzähligen gefahrenen Rallyes waren
begeisternd. Er ist heute siebenundfünfzig Jahre alt und will
unbedingt noch einmal an einem Rallye teilnehmen.

Die Flasche war bedenklich leer, als wir uns gute Nacht
wünschten.
Das wunderbar englisch eingerichtete Haus und der ganze Charme,
welches es ausstrahlte, werden mir in bester Erinnerung bleiben.


9. Mai 2009
Am nächsten Morgen ging’s los in Richtung Moissac. Ein
ausgesprochen unangenehmer Weg, eigentlich alles auf Asphalt.
Das Städtchen war klein mit einem wunderbaren mittelalterlichen
Kern und einer riesigen Kathedrale. Es war Samstag und der
grosse Markt bot alles, was das Herz begehrte, vor allem
Frischprodukte aller Art und in grosser Vielfalt. Eingemachte
Gänse- und Entenleber in allen Variationen waren fast an jedem
Stand zu haben. Leider konnte ich die schönen Produkte nur mit
den Augen bewundern, von kaufen war ja keine Rede, ich musste
weiter marschieren.




Der Weg in Richtung Lectoure war nicht besonders interessant,
wahrscheinlich auch darum, da grosse Atomkraftwerke, wie
Monumente, das Bild dominierten. Ja, und immer diese Hunde. Ob
die wohl auf Jakobswegwanderer abgerichtet sind? Obwohl in der
Regel hinter Gitter, sind die Bestien ausgesprochen aggressiv.
Auf meine Unterkunft im Lectoure „Chambre d’Hôtes“ war ich
gespannt. Es ist 17.00 Uhr und ich sitze in einem schönen
Strassencafé und genehmige mir einen trockenen Weissen.
Das Gîte befand sich mitten im Dorf. Joèlle Pans war eine
jüngere Gastgeberin, ihr Mann war eher der Akademiker-Typ. Man
trat über einen Hinterhof in das Anwesen. Ich war vom Haus
positiv überrascht. Ich zog mich um und ging zum zweiten Mal zum
Apero in den Dorfkern.


Um 19.30 Uhr war das Nachtessen angesagt. Die vier weiteren
Gäste waren aus der Pariser Region, was man eigentlich gleich
erkennen konnte. Der eine, ein geschwätziger Typ, kommentierte
alles, wusste alles und konnte, wie es bei solchen Leuten üblich
ist, nicht zuhören. Eigentlich das Wichtigere, das Essen war OK:
Entenbrust mit einem Linsengericht. Zum Nachtisch wurde ein ganz
spezieller Fruchtsalat mit verschiedenen Beeren zubereitet.
10. Mai 2009
Von „Lecture“ lief ich los in Richtung „Condom“. Bereits nach
einigen Km wurde der Waldweg immer sumpfiger. Bis zum Knöchel
sank ich ein, einen Ausweg gab es nicht. Der Pfad war durch das
dichte Gebüsch quasi eingerahmt. Nach zwanzig Minuten waren
nicht nur meine Schuhe, sondern auch meine Socken und somit auch
meine Füsse völlig durchnässt und dies nach nur ein paar Km. Ich
entschloss mich umzukehren und diesem unfreundlichen Weg nicht
mehr zu folgen. Die Strecke war ja berechenbar.
Es regnete in Strömen. Ich war gut ausgerüstet, hatte meinen
Regenüberhang und die Regenhosen ab, die mich schützen sollten.
Und trotzdem, das Kondenswasser, welches sich zwischen meinem
schwitzenden Körper und dem Gummizeug bildete, führte dazu, dass
nun nicht nur meine Füsse, sondern dass ich von Kopf bis Fuss
durchnässt weitergehen musste.
Zum Glück hatte ich den MP3 Player, den ich mir vor diesem
Abenteuer in einem Spezialgeschäft besorgt habe. Mit mehr als
2'000 Titeln bestückt, gab er mir einigermassen Garantie, dass
ich kaum zweimal das Vergnügen haben werde, dasselbe Stück
zweimal zu hören. Ja, Musik als Begleitung kann einem das Leben
in vielen Situationen versüssen. Besten Dank an Clémence und Pit,
die mir das Gerät gefüllt haben.

Den Rest meiner Tagesstrecke lief ich auf der asphaltierten
Strasse. Als der Regenfall
abnahm und schlussendlich aufhörte, sah die Welt ganz anders, ja
viel besser aus.




Die Vögel pfiffen, ja unter anderen erkannte ich auch sogar den
Gesang der Nachtigal, von der man sagt, sie sänge die schönsten
Melodien. Andere meinen, es sei die Amsel.
Wie ich erfahren habe, kommen die Amseln (Männchen) mit einem
Standard-Gesangs-repertoire zur Welt,. Danach kommt, je nach
Begabung, einiges dazu: Melodien welche sie anderen Singvögeln
ablauschen. Daher die Virtuosität und Unterschiedlichkeit der
Gesänge, welche die Amseln von sich geben können.
Ja, ich hatte wieder Freude, die schöne Landschaft zu betrachten
und all diesen Geräuschen und Tönen zu horchen. Und schon befand
ich mich im Armagnacgebiet.


In „Condom“ angekommen erkundigte ich mich nach meinem nächsten
Gîte „Castelnau sur L’auvignon“. Da ich der Hauptstrasse gefolgt
war, habe ich die Herberge prompt verpasst und hätte 12 Km
zurücktschumppeln müssen. Das war mir echt zu viel. Ich stellte
auf meinem Handy die Telefonnummer der Herberge ein und bat
meine zukünftigen Gastgeber, mich abzuholen.

Es war ein typisches Gîte mit lediglich zwei Gästezimmern mit
zwei und drei Betten. Janine und Andres waren nette Gastgeber.
Sie betreiben diese Gastgeberei aus rein materiellen Gründen.
Aus Mittelfrankreich kommend, haben sie hier Land gefunden und
das Haus, hauptsächlich in Eigenarbeit, gebaut. Andres ist seit
einiger Zeit arbeitslos. Er meint, dass in seinem Alter, um die
fünfzig, die Chancen für eine Stelle klein, wenn nicht
aussichtslos seien.
Ja, und so kam es dazu, da sich das Haus auf dem Weg befindet,
dass sie anfingen zwei Räume jeweils mit Halbpension an Pilger
zu vermieten. Pro Person 30 Euro. Hochsaison ist Mai und Juni,
danach kommen noch zwei Herbstmonate dazu.
In dieser Art Unterkunft sind die Rollen klar aufgeteilt und
erstaunlich vergleichbar. Die Frau ist der Chef und im
Vordergrund, er ist im Hintergrund und verrichtet Nebenarbeiten.
Es kommt einem vor, als ob er froh sein muss, da wohnen zu
dürfen.
Es war lediglich noch ein Gast anwesend. Ein komischer Kauz, der
kaum ein Wort sprach. Meinen Gruss erwiderte er kaum.
Beim Nachtessen, an welchem die beiden Töchter und der Freund
der einen teilnahmen, kam ein zögerliches Gespräch zustande.
Es war eine scheussliche Nacht mit diesem Kerl im Zimmer, der
schnarchte, dass sich die Balken bogen. Auf mein Pfeifen,
Schreien und Schütteln reagierte er nicht. Um
02.00 Uhr morgens flüchtete ich in den Vorraum und sank in ein
kleines aber rettendes Kanapee.
11. Mai 2009
Zurück in Condom, rief ich den Gepäcktransportdienst an, um
ihnen mitzuteilen, dass ich samt Gepäck bis Aire-sur-l’Adour
mitfahren möchte. Ich wollte diese Dienstleitung eins zu eins
miterleben. Lange musste ich nicht warten. Nach etwa zwei
Stunden kam der Kastenwagen angefahren.
Das Gespräch mit Michel war gut und wie er über sein
Unternehmen, das er mit seiner Frau seit zwei Jahren betrieb,
berichtete, war lehrreich. Täglich absolviert er oder sie 7-800
km Fahrt und dies grösstenteils auf Nebenstrassen. Ein
Kaffeehalt in einem Gîte und das Gespräch mit den Inhabern, die
Michel gut kannten, trug meinem Wissen noch einiges bei.



Wir fuhren mitten durch das Armagnacgebiet, das Herz ist das
Städtchen „Eauze“.
Aus dem Armagnac wird auch ein “Nebenprodukt“ hergestellt,
welches vorwiegend in diesem Gebiet angeboten wird. Der lokale
Aperitif nennt sich „Floc“. Die Herstellung erfolgt auf der
Basis des in der Regel 40 %igen Armagnacs und wird mit Rot- oder
Weisswein ergänzt, was ein angenehmes, kühlserviertes 17%iges
Getränk ergibt.
In Air-sur l’Adour fängt die Ära der „Stierkämpfe“ an. Auch
dieser Ort verfügt über eine Arena. Die Stiere werden bei diesen
Schauspielen nicht verletzt oder gar getötet. Es geht dabei um
die Geschicklichkeit der Toreros.
Ich bin im Hotel-Restaurant L’Ahumat untergebracht. Nach der
letzten Nacht war mir klar, dass ich nur Gästezimmer mit
Einzelzimmerbenutzung oder Hotels aufsuchen werde.
An diesem Abend war nicht viel los, ich ging in ein Café zum
Apéro und genehmigte mir zwei, drei „Flocs“ rote und weisse. In
der Gaststube des Hotels waren ausschliesslich Jakobswanderer
anzutreffen.
Ich konnte mir vorstellen, einige Ausnahmen ausgenommen, dass es
in einer Alterssiedlung etwa so aussehen könnte.
Diese Nacht schlief ich wie ein Stein, hatte ich doch die
vergangene Nacht neben diesem Ungeheuer verbringen müssen.
12. Mai 2009
Ich liess mir Zeit, pflegte meine Füsse und zog meine neu
erstandenen „Kompaktstrümpfe“ an, bevor ich mich in Richtung „Miramont-Sensacq“
aufmachte.
Ich zog los und fühlte mich gut in Form. Als ich zum Städtchen
hinauswanderte, fiel mir wiederum auf, dass in Frankreich,
zumindest in dieser Region, eine allgemeine
„Beschäftigungstherapie“ herrscht. Alle amtliche oder
Gemeindefahrzeuge waren mit einem Fahrer und einem Beifahrer
bestückt.
Über Land bemerkte ich die riesigen Äcker. Schier unendlich
schienen sie mir. Schätzungsweise 1 auch 1,5 km in der Länge
oder Breite, waren keine Ausnahmen über 100 ha, wenn ich mich
nicht täusche. Die Bewässerungsanlagen waren ebenso beeidruckend,
auf riesigen Rollen mit einer Breite von über 200 m.
Da dachte ich mir, und so soll unsere Landwirtschaft
konkurrenzfähig bleiben. Bei Bauernhöfen, welche im Durchschnitt
mit einem Umschwung von unter 15 bis 20 ha auskommen sollten,
wohl kaum.
Bei der Überquerung einer riesigen Autobahnbaustelle, in dieser
kam ich mir vor wie eine Ameise, erkundigte ich mich nach dem
Fortlauf des Weges. Die Lastfahrzeuge, die emsig Berge von Erde
abtransportierten, hatten eine von mir noch nie gesehene
Dimension. Die Räder überflügelten meine Grösse bei Weitem.
Da half mir meine französische Muttersprache deutlich und ich
konnte mich auch in diesem Durcheinander und Lärm durchfragen
und trotz allem den richtigen Weg wieder finden.
Nach „Latrille“ traf ich auf einen Pilger, den ich am Vorabend
mit einer Begleiterin am Nebentisch beobachtet hatte, was blieb
mir an diesem Abend wohl anders übrig. Sie sprachen intensiv
aufeinander ein, wie es ein Ehepaar kaum tun würde. Sie war
mittelhübsch und Vegetarierin. Nein, verheiratet waren sie
nicht, das Fehlen von Ringen sprach dieselbe Sprache, oder
deutete zumindest darauf hin.
Jedenfalls erkannte ich ihn wieder und sprach ihn in
französischer Sprache an. Er gab mir zu verstehen, dass er
dieser Sprache nicht kundig war. Darauf wechselte ich auf
deutsch. Darauf fragte er mich, ob ich Oestereicher sei? Mich!
Mit meiner roten, mit lauter Schweizerkreuzchen beschmückten
Kopfbandage. Dabei dachte ich mir, hat man schon einen
Österreicher französisch sprechen hören?
Darauf sagte ich ihm, wir waren gestern Tischnachbarn. Ach ja?
Erwiderte er,
„stimmt, ich erinnere mich“.
Darauf zog ich los, mit den Worten „ich wünsche Ihnen einen
schönen Weg“.
An diesem Tag kam ich mir wie ein junges Reh vor, das davon flog
und schon bald traf ich in „Miramont-Sensacq“ ein.
Das Hôtel-Restaurant Beaumont war sauber und mit einfachen
Zimmern ausgerüstet.
Alle dies Hôtels, die empfohlen werden, sind von einfachsten
Standard und günstig im Preis. Je nach der Ortschaft zwischen
30-40 Euro, inklusive Halbpension.
Nach dem Abendessen, es war wieder mal Entenkeule angesagt,
begab ich mich in die vereinsamte Bar. Die Wirtin und
Besitzerin, sie besass ein schönes Gesicht, welches von dunklen
lockigen Harr umgeben war, erzählte mir nach einiger Zeit ihre
Lebensgeschichte. Erstaunlich, war sie doch den ganzen Abend so
zurückhaltend.

Nach dem dritten Armagnac wusste ich, dass ihr Mann vor fünf
Jahren gesundheitlich Pech hatte und den Küchendienst aufgeben
musste. Früher hatten sie mit dem einzigen Hôtel-Restaurant
Betrieb an Ort allerhand zu tun. Hochzeit, Tauffester an
Wochenenden und über die Woche viele Mittag- und Nachtessen wie
auch regelmässige Übernachtungen mit Gästen, die einen
ordentlichen Preis bezahlten.
Nun ist das Ganze auf den Empfang der Pilger geschrumpft. Ob sie
davon leben können? Wahrscheinlich eher knapp.
13. Mai 2009
Am Morgen um 09.00 Uhr zog ich los. Der Himmel war schwer
bedeckt. Zum Glück regnete es in der Nacht stark und das Nass
hat sich am Morgen zurückgezogen. Ich zog
an grossen Zuchtbetrieben vorbei. Die Stallungen für die Rinder
bestanden aus überdimensionalen Unterständen, welche auf drei
Seiten als Wind- und Wetterschutz geschlossen waren. Die Rinder
waren riesige beige-weisse Tiere. Ich schätzte über hundert
Stück pro Hof. Die Schweinezuchten konnte man von Weitem
riechen. Bei diesem Gestank konnte man sich kaum vorstellen,
dass diese Tiere mal auf einem Teller landen. Auch die
Entenfarmen waren beeindruckend und in unseren Gebieten kaum
vorstellbar. Von weitem kam es einem wie ein weisses Feld vor.
Auffallend waren die Unordnung und der Schrott, der auf diesen
Höfen herumlag. Ein Emmentaler Bauer würde sich kaum getrauen
nur hinzuschauen.
Der Weg nach „Arthez-de-Béorn“ über „Arzacq-Arraziguet“ war
steinig, oder anders gesagt, teilweise ausgesprochen sumpfig.
Für ein Km benötigte ich teilweise über eine halbe Stunde.
Erstaunlich, dass die Gemeindenverwaltungen nichts unternehmen,
um diese Wege auszutrocknen, zum Beispiel mit altem
Ziegelmaterial oder sonstigen naturfreundlichen Materialien zu
belegen. Lebt doch ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung
von diesem Weg.
Im Café du Palais machte ich den ersten Halt, genehmigte mir
einen Drink und spielte eine Runde Billard.
Der Empfang der Gastgeber, Irène und Edward Lawrenson, wie auch
die Unterkunft haben mir auf Anhieb einen guten Eindruck
gemacht. Alles war gemütlich, aufgeräumt und freundlich.

An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass auf diesem Weg die
Gastfreundschaft wie erstaunlicherweise auch das Essen der
Engländer (englische Gastgeber) überzeugt. Dies kann man von den
französischen Gastgebern nicht behaupten. So unter dem Motto
„das Geld schicken und gar nicht vorbeikommen“. Es soll auch,
vor allem englische Gastgeber geben, welche Unterkünfte aus
gesellschaftlichen Gründen führen und dies mit besten
Speiseangeboten zu konkurrenzlosen Preisen.
Das Abendessen bei Jèren und Edward war das Beste bis zu diesem
Tag. Die Unterhaltung bei Tisch mit den drei älteren Damen,
welche ebenfalls unterwegs waren, war ausgesprochen
unterhaltsam. Ich habe Lydie Carrière, Lucette Celis und Monique
Rouchon zu meiner traditionellen Neujahrsparty am 2. Januar um
17.00 Uhr eingeladen.

14. Mai 2009
Als ich nach einem Kaffee in Richtung „Maslacq“ aufbrach,
regnete es in Strömen. Der Fluss, ein riesiges Gewässer Namens „Gave
de Pau“, welcher in den „Adour“ fliesst, überquoll bereits. Das
Wetter war nicht auf meiner Seite und spielte verrückt. Der
Hagel, der scheinbar immer überraschend kam, hatte in den
letzten Tagen viele Reben und Tausende von ha Gemüseanbaufläche
zerstört.
Im Hotel „Mongouber“ kehrte ich zu einem Kaffee ein.
In diesen kleinen Ortschaften wird ab Verkaufswagen eingekauft,
wie bei uns vor vierzig Jahren. Der Gemüsler, der Fleischer, der
Molkereiproduktefahrer und wahrscheinlich auch der Fischanbieter
fahren vorbei, nehmen die Bestellungen auf und bringen die
Produkte an die Theke.
Am Ziel eingetroffen, habe ich im Hotel Central ein schönes
Zimmer bezogen, das Haus wurde in den zwei letzten Jahren
ausgehöhlt und geschmackvoll umgebaut und eingerichtet. Auf
meinem Rundgang im Dorf stiess ich auf eine Kapelle mit
wunderschönen, einzigartigen Familiengräbern.





Ich freute mich nun auf den Apéro, den ich im Café „de la place“
einnehmen würde.
Die Wirtsleute waren offen und gesprächig. Die beiden bringen
gemeinsam sicher über 250 Kilogramm auf die Waage.

Jean-Pierre und seine Frau erzählten mir viel über ihre
Vorfahren, über die Gemeindepolitik, über die Region und über
Weiteres mehr. Vor lauter Zuhören habe ich beinahe meinen Hunger
vergessen. Es war bereits über 19.30 Uhr.
Die Auswahl für das Abendessen war nicht riesig und ich
entschloss mich wieder mal für die Entenkeule. Wenn das so
weiter geht, dachte ich mir, würden mir wohl bald Flügel
wachsen. An einem entfernten Tisch sassen zwei Schweizer, die
ich, nach dem Käse, an ihrem Tisch aufsuchte. Es stellte sich
heraus, dass sie aus Luzern waren. Sie sind Brüder und beide
Juristen. Der eine betreibt eine grössere Anwaltpraxis und der
andere ist Polizeikommandant von Luzern. Unsere Gespräche waren
interessant und angeregt. Die beiden Brüder habe ich auch zu
meiner Neujahrsparty eingeladen.
Die beiden Brüder tippeln den Weg in Etappen ab, Wochen- und
Zweiwochenweise.
Ich hatte mir zum Nachtessen eine Flasche Roten genehmigt. Der
Armagnac, den wir gemeinsam einnahmen, war wohl das geeignete
Schlafmittel.
15. Mai 2009
Der Tag präsentierte sich grau in grau. Der ganze Weg über
Asphalt und Stock und Stein, Wind und Regen war nicht unbedingt
ein Aufsteller. Erst später zeigten sich ein paar zögerliche
Sonnenstrahlen. Die Marschzeit versuchte ich mit Pfeifen und
Gesang zu versüssen, es gelang mir einigermassen. Unglaublich
wie viel unterschiedliche Melodien man nacheinander hinbekommt,
aufs Tapet bringt, ohne die Selben zu wiederholen. Das Spiel
ging schier zwei Stunden. Jedenfalls war ich glücklich, das Ziel
erreicht zu haben. Trotz mieser Sicht konnte ich von hier aus
bereits den Beginn der Pyrenäen erblicken.
Hier in „Larceveau“, hatte ich die herzige Herberge „Le Trinquet“
entdeckt, in der ich mich wohlfühlend unterbringen liess. Ein
schöner Ort. Ich war an diesem Abend der einzige Gast. Auf der
Speisekarte war Fisch und Schwein angesagt. Ich fragte nach Rind
oder, eben, Ente. Das Steak, welches ich serviert bekam, war in
der Form unde- finierbar gross. Ich habe mich buchstäblich durch
diese Mahlzeit durchgearbeitet. Geschmacklich war das Stück
Fleisch einzigartig. Das Kunststück war, die richtigen Teile
dieses Monsters zu erreichen. Den Wein, den ich dazu bestellt
hatte, passte hervorragend dazu. Ein Navarra, Jahrgang 2004. Ja,
ich war ja bereits in der Nähe von Spanien.
Wie das Leben eben so spielt, die beiden Luzerner habe ich an
diesem Ort wieder getroffen und logischerweise haben wir das
Gespräch vom Vorabend wieder aufgenommen. Joseph und Hans-Kaspar
waren angenehme Gesprächspartner. Auch an diesem Abend wurde es
etwas später.
16. Mai 2009
Nun bin ich bereits seit über zehn Tage unterwegs. Es kam mir
wie eine Ewigkeit vor.
Die Strecke von „Larceveau“ nach „Saint-Jean-Pied-de-Port" war
nicht anspruchsvoll und doch haben die rund vierzig km
eingeschenkt. Ohne Umwege wären es etwas über zwanzig km
gewesen. Der Asphalt auf der letzten Strecke war hart, das
Wetter hingegen war sanft und sonnig. Nach den letzten
Regentagen war dies ein echtes Geschenk.
Ungefähr zwölf km vor dem Ziel fuhr ein Personenwagen direkt auf
mich zu. Ich dachte mir „was soll das“ und schon hielt das
Vehikel neben mir an. Siehe da die Luzerner! Sie waren bereits
auf dem Weg nach Hause. Eine der Ehefrauen hat sie in „Pied-de-Port“
mit dem Privatwagen abgeholt.
Der Polizeichef von Luzern, der hinten im Wagen sass, hielt mir
ein Baguette und ein Apfel entgegen. „Zwischenverpflegung, du
musst regelmässig etwas essen“, rief er mir zu. Nach einer
kurzen freundlichen Unterhaltung brausten sie davon und ich
trampelte weiter. Von diesen beiden blieb mir eine gute
Erinnerung und ich dachte an die paar Begegnungen, die wir
hatten.
17. Mai 2009
In „Saint-Jean-Pied-de-Port“ angekommen musste ich feststellen,
dass ich wohl einen Ruhetag einplanen muss, denn mein linkes
Schienbein war stark angeschwollen.






Die Entzündung hat sich, trotz Salben, stark ausgedehnt. Die
Asphaltstrasse hat da stark mitgewirkt. Eine freundliche
Apothekerin am Ort hat mich mit entsprechenden Medikamente
versorgt und auf meine Frage auf ein Insider Typ punkto
Restaurant eine Adresse durchgegeben. Darauf bin ich gleich in
das Restaurant gegangen, um für den Abend einen Tisch zu
reservieren.
Die Empfehlung war in Ordnung. Im Restaurant „Paxcal Oillarburu“,
wohl ein basquischer Name, isst man wirklich gut. Der Inhaber,
wie sich herausstellte, war tatsächlich ein Basque und kocht nur
mit der Unterstützung einer Gehilfin alleine.
Nach dem Hauptgang, ich entschied mich nochmals für die Ente,
vor dem Käse beschloss ich zu dislozieren und zwar in die Bar im
Nebenraum.
Mit dem einheimischen Publikum habe ich mich gleich unterhalten
und gut verstanden.


Jean-Baptiste, welcher in einem Altersheim arbeitet, Beüat
bedient eine Wischmaschine der Gemeinde und Paxkal, der Maurer
würden für mein Buch ein gutes Titelbild abgeben.
Hier spielt sich alles zweisprachig ab, sämtliche Informationen
sind in französisch und basquisch angeschrieben. Die basquische
Sprache ist für uns unverständlich. Ebenfalls wird man aus der
Schrift nicht schlau. Es könnte eine östliche wie auch eine
arabische Sprache sein.
In dieser Bar waren einige Männerportraits eingerahmt an der
Wand aufgemacht. Auf meine Frage ob es sich um Dorfpolitiker
handle, wurde ich aufgeklärt, dass es Basquen seien „die für
unsere Sache kämpften“, nun seit fünf Jahren im Gefängnis sässen
und dies ohne Prozess. Für mich ein Novum, dass es solche
Umstände in einem EU-Land gibt.

18. Mai 2009
Für den spanischen Teil des Weges habe ich mir das Büchlein
„Spanischer Jakobsweg“ (Wandern kompakt vom Bruckmann Verlag)
besorgt. Gut dokumentiert, mit Karten und ausführlichen
Beschreibungen der Wegstrecken. In Pamplona fiel meine
Entscheidung und zwar eindeutig: Ich werde diesen Weg nicht zu
Ende führen.


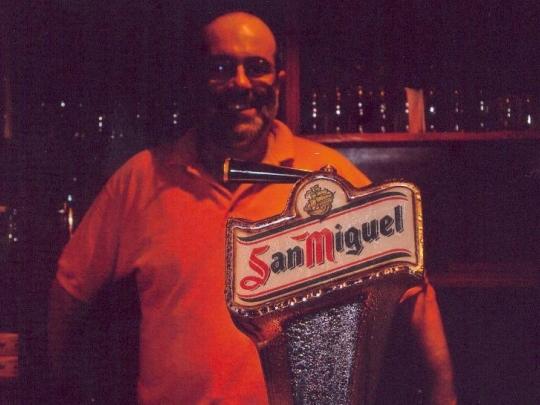
Bis „Burgos“ werde ich gehen, ein absehbares Ziel. Pamplona eine
wunderschöne Stadt, teilweise bestehen die Quartiere noch aus
dem Mittelalter. Die alten gepflegten Gassen mit den unzähligen
kleinen Spezialitäten-Geschäften war ein Genuss zum
hineinschauen. Es erinnerte mich an meine Kindheit, besassen
doch meine Eltern ein Comestible-Geschäft mit ebenso vielen
Frischprodukten und Spezialitäten. Auch hier sind die Bars und
Restaurants typisch, eben spanisch. Unzählige ganz
unterschiedliche Tapas rufen ein stetiges Hungergefühl hervor.
Abends, an einer dieser Bars, kam ich mit Elena und Stéphan ins
Gespräch. Sie waren eben ein Jahr verheiratet, wie ich erfuhr,
und leben heute in der Normandie. Dies war mir zusätzlich
sympathisch, da ich diesen Landesteil Frankreichs in bester
Erinnerungen habe. Als ich feststellte, dass mich die junge Frau
ziemlich in Beschlag nahm und der junge Ehemann mich eher
skeptisch schilderte, beschloss ich ziemlich kurzerhand, mich
höflich zu verabschieden. Sie konnte oder wollte es nicht
unterlassen, aus welchem Grund auch immer, mir ihre Karte mit
ein paar netten geschriebenen Worten zu überreichen.
Ja, wie organisiere ich mich nun weiter. Spätestens in Burgos
werde ich meine Pläne ändern. Ich begab mich in ein kleines
Reisebüro, denn die Rückreise in die Schweiz war ja auch ein
Thema.
Diego Rubio, Mitinhaber des Reisebüro „Turnasol Viajes“, eine
sehr nette Persönlichkeit, las mir quasi meine Wünsche von den
Augen ab und wir beschlossen, dass ich von Burgos mit einem
Nachtbus nach Benidorm fahren werde, um dann zwei Tage später,
wieder mit dem Bus, nach Alicante weiterzureisen, dort das
Flugzeug zu besteigen und in Richtung Zürich zu fliegen. Schon
in diesem Moment konnte ich es nicht erwarten, in meine schöne
Schweiz zurückzukehren.
Das bedeutete, dass ich nach den noch bevorstehenden
Marschstrapazen mit einem Nachtbus, Abfahrt 23.00 Uhr, Ankunft
in Benidorm um 06.30 Uhr, fahren muss. Ein Einzelzimmer, trotz
happigem Zuschlag, musste es schon sein.
Scheinbar war das Buchen eines Einzelzimmer in einem adäquaten
Hotel keine einfache Sache. Jedenfalls verbrachte ich über zwei
Stunden am Arbeitspult von Diego.
Als ich alle notwendigen Papiere und Dokumente besass und die
Rechnung bezahlt hatte, verabschiedete mich Diego mit den Worten
„wenn du das nächste Mal in Pamplona bist, brauchst du kein
Hotel zu buchen, sondern du wirst mein Gast sein und wohnst bei
uns“. Ich solle nach Pamplona kommen, wenn die grossen
Festivitäten stattfinden, wenn die Stiere durch die Gassen
getrieben werden. Das Volksfest dauert eine Woche.
Meine Kehrtwendung ist im Grunde genommen einfach zu erklären.
Tagelang, ja wochenlang über 40 Km vor mich hin zu marschieren,
ohne eigentliches Ziel, ich sah es jedenfalls nicht, ohne
Höhepunkte, wie zum Beispiel ein Berggipfel zu bezwingen, hat
mir die Laune genommen. Dazu kam, dass ich von Tag zu Tag
feststellen musste, wie die ganze Angelegenheit, die sich
Jakobsweg nennt, einen ausgesprochen kommerziellen Beigeschmack
hat.
Die Begegnungen mit den Einheimischen waren erfrischend.
Die Leute, Frauen und Männer, meist über 60 Jahre alt, die ich
auf dem Weg angetroffen, gekreuzt und überholt habe, kamen mir
als graue, verschlossene Gestalten vor. Das Gerangel in den
Unterkünften war schon fast zeremoniell. Der Geiz unterwegs und
in den Unterkünften war ihnen buchstäblich anzusehen. Nein, das
konnte so nicht weitergehen.
Einige Tage werde ich noch gehen, bis Burgos. Doch das Feuer,
welches sich bei mir auf diesem Weg kaum entflammte, war
erloschen. Zur „Kür“ kam nun die „Pflicht“, die ich mir selbst
auferlegt hatte. „Burgos“ tönt gut, etwa 270 km, das war soweit
in Ordnung. Und trotzdem dachte ich mir im Innersten, wieso habe
ich nicht bereits in „Pamplona“ den Bus bestiegen. Ein Trost die
ganze Heimreise war geplant und gebucht.
26. Mai 2009
Die Busreise von „Burgos“ nach „Benidorm“ war angenehm. Wobei
nach dieser Marschiererei wahrscheinlich jede Reise in einem
Fahrzeug so empfunden wird. Die Nachtfahrt, die mit 7-8 Std.
angesagt war, noch nie war ich mit einem Car so lange unterwegs,
erwies sich als Vorteil.

Früh morgens trafen wir in „Benidorm“ ein. Ein riesiges
Car-Terminal nahm uns in Empfang, auch dies war Neuland für
mich. Dass ich mal hier landen würde, hätte ich mir in meinen
kühnsten Träumen nicht vorstellen können.
Ich bestieg ein Taxi und nannte dem Fahrer den Namen des Hotels.
Ich kannte den Ort visuell von Durchfahrten. Die „Urlaubsilos“
wie aus der Retorte gebaut, eine riesige Alterssiedlung.
Unglaublich die Dimension der Gebäude, 30 Stockwerke, zum Teil
auf weniger als 200 m2. Der Ort besteht grundsätzlich aus
Hochhäusern auf schmalsten Parzellen. Unglaublich, sich diese
Stadt vorzustellen, ohne es selbst gesehen zu haben.








„Benidorm“ ist eine Stadt mit 60'000 Einwohnern, in der
Hochsaison beherbergt diese Stadt über eine halbe Million
Touristen.
Ja klar, ich kam ja um 07.00 Uhr mit dem Taxi beim Hotel an und
konnte mein Zimmer noch nicht beziehen, ein Riesenschiff mit ca.
300-400 Zimmern. Der Nachtportier gab mir um diese Frühzeit
freundlich zu verstehen, dass ich mein Gepäck, zwei
prallgefüllte Rucksäcke, deponieren könne. Das Zimmer hingegen
wäre erst um 14.00 Uhr bereit.
Dies gab mir die Gelegenheit, die Küste im morgendlichen
Sonnenschein abzulaufen. Ich war über zwei Stunden unterwegs. Es
war ziemlich eindrücklich, zu dieser Tageszeit diese „Insel“ zu
entdecken.
Ja, diese neue Situation war mehr als angewöhnungsbedürftig.
Bereits um 10.00 Uhr durfte ich mein Zimmer beziehen. Nach der
Einrichtung begab ich mich in die Freiräume, Schwimmbad usw. Was
ich da antraf, und das betrifft ebenfalls den Strand, den ich in
einigen Stunden ablief, war unglaublich.






Die Aufzüge gaben eine maximale Belastung von 600 kg an. Hier
war in der Regel bei drei Personen, zumindest optisch, das Mass
voll. Noch nie habe ich so viele gewichtige Menschen auf einen
Punkt fokussiert wahrgenommen.
Doch nach einigen Stunden hatte ich mich einigermassen
eingelebt. In einem Haus mit 800-1'000 Gästen musste alles top
funktionieren, ohne Ausnahme hatten alle Vollpension. Die Gäste
wie auch das Personal waren ausgesprochen freundlich und
aufmerksam. Die Mehrheit der Gäste waren Franzosen und
Engländer. Es soll hier mindestens 40% günstiger sein als bei
ihnen zu Hause.
Am Abend liess ich mich mit dem Taxi an die linke Küste fahren.
In einem amerikanischen Rock-Café, die Band war überwältigend:
Keybort, Schlagzeug, zwei Gitarren, Bass und ein unerhört guter
Sänger. Er wusste es auch.
Wieder mal ein Abend, der ein Aufsteller war. Spät am Abend,
oder früh am Morgen, fuhr ich mit einem Taxi zurück ins Hotel.
Am nächsten Morgen spürte ich den letzten Jack Daniels, der wohl
zuviel war. Von meinen rund 1'900 Euros fand ich auf dem Tisch
meines Zimmers lediglich noch drei zweihunderter Noten. Ist
jemand in mein Zimmer eingedrungen, während ich schlief? Und
wieso haben die nicht alles Bares mitgenommen? Habe ich beim
Bezahlen des Taxis einen Teil meines Bargeldes, welches ich
ohnehin immer in zu grossen Mengen mittrage, wahrscheinlich aus
der Zeit „nur Bares ist wahres“, verhühnert?
Logischerweise begab ich mich auch am zweiten Tag wieder ins
Rocklokal, wo am späten Nachmittag bereits eine Band spielte.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, stellte ich fest, dass nun
auch der Rest meines Geldes, ca. 550 Euro, verschwunden waren,
inklusive meiner Visa und Identitätskarte.
Nun war es klar, man ist bei meinem Tiefschlaf wiederum bei mir
eingedrungen und ich wurde buchstäblich in Etappen ausgeraubt.
Jedenfalls war ich nach dieser Feststellung im Nu hellwach und
niedergeschlagen. Ich begab mich blitzschnell an die Rezeption
und versuchte dem Frontpersonal die Fälle zu erklären. Das
Kopfschütteln und die Gesichter, welche Unglauben zum Ausdruck
brachten, gab mir in meiner gekränkter Stimmung keinen
Aufschwung. Der bestellte Techniker des Hauses, der mit einem
Spezialgerät, die Karteneinschübe mengenmässig und zeitlich
feststellen konnte, konnte zwischen 23.00 Uhr, das war die Zeit
als ich das Zimmer aufsuchte, und 09.30 Uhr keine Eintragungen
feststellen. Eine fremde Karte konnte somit nicht im Spiel sein.
Der Hoteldirektor, auf den ich verwiesen wurde, kreuzte erst um
die Mittagszeit auf. Er bat mich höflich in sein Büro und hörte
meine Geschichte wortlos an. Was wollte ich da überhaupt, dachte
ich mir. Wie würde ich reagieren, wenn mir einer von 800-1'000
Gäste mit dieser Geschichte auffährt?
Auf meine Forderung, ein anderes Zimmer zu beziehen, ging er
freundlich ein. Ich konnte somit vom Elften ins siebzehnte
Stockwerk umziehen.
Beim Einpacken meiner Effekten kamen unter dem Stern und Spiegel
die 550 Euro und die Visa, die ich in der Zwischenzeit unter
komplizierten Umständen sperren liess, wie auch die ID zum
Vorschein.
Nun ich war offengestanden erleichtert, nicht nur um die 1'300
Euros, die ich wahrscheinlich am Vortag verhühnert hatte,
sondern echt erleichtert, dass ich wohl nicht ausgeraubt wurde.
Ja, das Leben in einem Gruppenhotel spielt sich alle Tage gleich
ab, selbstverständlich mit Vollpension. Über das Buffet konnte
man sich nicht beklagen, mit der nötigen Fantasie war es
möglich, etwas zusammen zu stellen. Gewürzt war eigentlich
nichts. Ich schnappte mir immer Öl, Essig, Salz und Pfeffer und
dann begann das Zeremoniell des Würzens.
Die Essenskultur, die da vorherrscht, war buchstäblich desaströs.
Nicht nur, dass beim Trinken die Gläser vollhändig gepackt
werden (wieso hat ein Glas einen Stiel?). Eine Vielzahl der
Gäste lag förmlich auf den Tellern. In vielen Fällen, da sie
durch ihre Üppigkeit gar nicht zum Tisch kommen konnten. Der
Höhepunkt war ein Paar, welches sieben prallvolle Teller, die
sie kaum auf den Tisch brachten, heranschleppten, bevor „das
grosse Fressen“ (La grande bouffe) begann. Der Gipfel meiner
Beobachtung war, dass jeweils alles aufgegessen wurde.
Ich pickte mir jeweils ein paar „Rosinen“ vom Buffet. Dazu
begleitete mich mittags eine Flasche Weissen und abends eine
Flasche Roten.
Was mir ebenfalls auffiel in diesem Teil Spaniens, oder anders
gesagt in diesem Ambiente, mehrheitlich bei spannischen Gästen,
dass die Männer von ihren Damen wie „Dienstboten“ behandelt
wurden.
Kann damit zusammenhängen, dass die Rentner das Zepter abgegeben
haben und nicht mehr zu den Beutemachern gehören?
Die in der Hotelumgebung täglich angebotene Spiele wie
Bogenschiessen, Petanque, Gewehr- und Pistolenschiessen à la
„Club Mediteranée“, nur eher verdünnt, sind willkommene
Abwechslungen zum Nichtstun und um die Eintönigkeit zu
verkürzen.
Uff, heute ist Abreisetag, die Rückreise beginnt: „Benidorm“- „Alicante“-
„Zürich“.
Nun war ich rund einen Monat von zu Hause weg.
Am Flughafen von „Alicante“ kam ich mit einem Franzosen, der an
der Information arbeitet, ins Gespräch. Auf meine Frage, ob er
da wohne, teilte er mir mit, ja seit drei Jahren. Wieso. fragte
ich weiter. Er gab mir zu verstehen, dass der Lebensstil der
Spanier für ihn ausschlaggebend sei. „Zuerst kommt das Leben,
das Wohlbefinden und dann erst das Materielle“. Das war der
Grund seiner Entscheidung, sich hier einzurichten, obwohl er zu
Hause das Dreifache verdienen könnte.
Ja, das Wohlbefinden, „Le bien être“, kann man nicht kaufen, das
fühlt man.
Einen Rucksack voller Eindrücke trage ich mit nach Hause. Die
Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit meiner Eindrücke können
kaum übertroffen werden.
Eines bin ich mir jedoch bewusst.
Der Jakobsweg kann nicht als Alternative dienen.










|